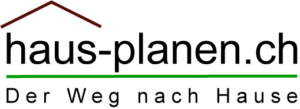Standortwahl
Die Lage Ihres zukünftigen Heims ist ungemein wichtig, damit Sie sich wohlfühlen. Genau wie die Einrichtung des Hauses muss sie mit Ihren Bedürfnissen und Wünschen übereinstimmen. Überprüfen Sie bei Ihrem Wunschstandort, ob in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind und wo sich Post, Kindergarten, Kinderarzt und Schulen befinden. Ausserdem sollten Sie abklären, wie es mit den Verkehrsbedingungen, sprich Zufahrtsstrassen und öffentliche Verkehrsmittel, steht. Es kann gut sein, dass Sie mit einem Haus im Grünen ein (Zweit-)Auto brauchen.
Lärmemissionen, Wegrecht, Sicht u.a.
Bevor Sie ein Grundstück kaufen, lohnt sich der Gang zur Gemeindekanzlei. Werfen Sie dort einen Blick auf das Altlastenkataster. So finden Sie heraus, ob beispielsweise der Untergrund des Bauplatzes belastet ist oder eine neue Strasse geplant ist, von welcher Lärmemissionen zu erwarten sind. Ausserdem erfahren Sie auf dem Bauamt, ob vor Ihrem zukünftigen Haus allenfalls eine Überbauung geplant ist.
Klären Sie zudem beim Grundbuchamt ab, ob Dienstbarkeiten bestehen, z. B. ein Wegrecht. Sie können sich auf der Gemeindekanzlei gleich auch noch nach den Baulandpreisen und dem Steuerfuss der Gemeinde erkundigen.
Bauen im Baurecht
Wenn Sie selber bauen wollen, kann der Landanteil gut und gerne 30 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Günstiger fahren Sie, wenn Sie im Baurecht bauen. Das heisst, Sie zahlen jährliche Baurechtszinsen für ein Grundstück, das einem Baurechtgeber (Private, Gemeinden) gehört. Solche Baurechtsverträge können für eine Dauer von bis zu 100 Jahren abgeschlossen werden. Wird der Vertrag danach nicht verlängert, geht die Immobilie gegen eine Entschädigung an den Baurechtgeber. Beachten Sie allerdings, dass Banken solche Projekte weniger gerne finanzieren. Und Achtung: Es gibt günstige Baurechtszinsen und es gibt Wucher. Informieren Sie sich deshalb gut, bevor Sie auf einen Baurechtsvertrag eintreten.